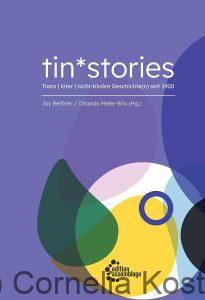Elizabeth Duval veröffentlichte Mitte 2023 das Buch „Nach Trans – Sex, Gender und die Linke“. Nachdem in der Zeit davor im deutschsprachigem Raum vor allem transfeindliche agitprop Pamphlete erschienen wie Shrier „Irreversibler Schaden“, Engelken „ Trans*innen? Nein, danke!“, Lieb „Alle(s) Gender“, Schon „Raus aus dem Genderkäfig!“ und Schwarzer&Louis „Transsexualität“ war es eine Wohltat, sich mit Duvals sorgfältig durchdachten und von Sachkompetenz geprägten Thesen zu beschäftigen.
Sie definiert Geschlecht als „die größere Empfänglichkeit mancher Menschen für bestimmte Botschaften und die Verinnerlichung von Rollenbildern.“ Dies führt „zu einer unbewussten Identitätsbildung“ und das „ist nicht nur soziokulturell vermittelt, in vielen Fällen sind auch Biologie und Genetik auf eine schwer zu quantifizierende Weise beteiligt.“ Sie spricht vom „Erwerb von Geschlecht beziehungsweise … von Geschlechterdifferenz.“ (S.46)
Sie ist „der Ansicht, dass das eigene Geschlecht nie selbstbestimmt ist. (Sie ist) vielmehr davon überzeugt, dass das Geschlecht maßgeblich von einer dem Subjekt fremden Bestimmung geprägt wird, die ihren Ursprung zunächst in dem von Gesellschaft und Familie vermittelten Erwerb hat und dann einer Internalisierung unterliegt, die weit davon entfernt ist, ein bewusster Prozess zu sein. Dieser Internalisierung und Bestimmung kann … in der Tat eine biologische Komponente hinsichtlich der Empfänglichkeit für bestimmte Botschaften innewohnen … .“ (S.50)
Damit würde sie argumentativ in die Nähe von Julia Serano kommen, von der sie sich allerdings distanziert. Das ist verständlich, da sie sich in einem psychoanalytischen und linksdiskursiven Argumentationsumfeld aufhält, also einem eher transkrititischen Denkmilieu.
Deshalb überrascht es nicht, folgenden Satz zu finden „ein Individuum ist nicht automatisch eine Frau , weil es sich als Frau begreift oder definiert – und als Folge dieser Entscheidung beziehungsweise Selbstbestimmung dann eine Frau ist. …“man (ist) eine Frau, weil sich die eigene imaginäre Identifikation auf eine bestimmte Weise entwickelt hat, manchmal sogar dem Individuum zum Trotz.“ „… weil man auf der Grundlage einer Relationalität als solche konstruiert wurde …“. „Das Subjekt verinnerlicht eine beträchtliche Anzahl von Verhaltensweisen, die der jeweiligen Geschlechternorm entsprechen und … zu dem führen, was Lorber »vergeschlechtlichte sexuelle Skripte« und »vergeschlechtlichte Persönlichkeiten« nennt, die wiederum seine sexuelle Orientierung, seine vergeschlechtlichte Persönlichkeit und seine Gender-Darstellung ausmachen. Und all das zusammengenommen führt letztlich zu einer Identität.“ (S.53)
Es kommt ihr nicht in den Sinn, das Geschlecht zu den evolutionär archaischsten Phänomenen gehört, die lange vor den Nervenzellen entstanden. Das Geschlecht sitzt eben nicht zwischen den Ohren und das Gehirn erweist sich als unfähig, geschlechtliche Selbstwahrnehmung zu steuern. Weshalb zur Phänomenologie von Transgeschlechtlichkeit ein progredienter Kontrollverlust über die eigene geschlechtliche Wahrnehmung gehört. Dieser lässt sich nicht durch die Variation von Verhaltensweisen oder die Modifikation von Gender-Expression auflösen.
Duval geht sogar so weit zu behaupten „Geschlechtsidentitat bildet sich mitunter erst in dem Moment, da sie sich offenbart, und verwandelt sich in dem Augenblick, da sie sich manifestiert, in die Wahrheit des Subjekts – in diesem Moment wird die Gegenwart gewissermaßen der Vergangenheit und der (persönlichen) Geschichte injiziert, beziehungsweise die Gegenwart erfindet sich die Vergangenheit.“ (S. 55)
Damit führt sie ihre im Kern konstruktivistische Herangehensweise auf die Spitze, indem sie das kontinuierliche Entwicklungsmoment von Transgeschlechtlichkeit verwirft. Selbst wenn es richtig ist, dass wir die Ursache nicht kennen, ist es entscheidend, Phänomenologie und auslösende Faktoren davon abzugrenzen.
Sie hält „die größer werdende Anzahl von trans Menschen in der westlichen Welt“ für eine Phänomen unserer Zeit, die „ohne eine Annäherung der Weiblichkeit an die Männlichkeit und umgekehrt nicht möglich“ wäre. „Und sie wäre nicht möglich ohne eine Androgynisierung unserer Gesellschaften, die sich in einer Auflösung der Unterschiede niederschlägt, … . (S. 47)
Sogar eine „Nähe von trans Frauen oder generell der Trans-Community zu Informatik und zum Virtuellen ist (für Duval) nichts Verwunderliches , denn solche (virtuellen) Räume begünstigen …, dass das Geschlecht auf korrumpierte, veränderte Weise oder in der Form eines Glitches erworben wird und nicht mehr notwendigerweise mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt oder mit jenem zusammenfällt, mit dem das Subjekt in seiner Relationalitat alltäglich in Verbindung gebracht wird.“ (S. 55)
Das sind Argumente aus dem Arsenal von „ROGD-Apologeten“, die geschlechtliche Vielfalt als eine Art „Virusinfektion“ diffamieren, angeblich ausgelöst von sozialen Faktoren. Es ist die gewachsene Akzeptanz von sexueller Vielfalt und die größere Verfügbarkeit an Informationen, die in der Folge eine Steigerung der Sichtbarkeit von geschlechtlicher Vielfalt mit sich bringt. Das ist eine ähnliche Entwicklung, wie es vor 100 Jahren mit der steigenden Akzeptanz der Linkshändigkeit geschah, es wurden deutlich mehr Linkshänder sichtbar.
Würde trans auf eine materielle Realität reduziert, behauptet Duval, wäre die „trans Existenz eine Art Gott-Konzept, der unhinterfragbare Herrensignifikant … einer vergeschlechtlichten Metaphysik.“ Weiter meint sie, „die Bezeichnung von trans als »materielle Realität« (sei) ein Beispiel desselben Fetischismus mit dem »Materiellen«, der einen großen Teil der trans-ausschließenden Reaktion sowie jener linken Tendenzen antreibt, … .“ Für sie gehört trans Sein kritisiert, in frage gestellt und diskutiert, sonst würde aus trans „ein beinahe religiöses Tabu, das jedwede Möglichkeit der Debatte ausschließt.“ (S. 64)
Diskutieren tut Duval in ihrem Buch ausführlich und gründlich. Sie entpuppt sich als Vertreterin des, in der Community richtigerweise verworfenen, Identitätsansatzes. Insofern ist ihre Argumentation rückwärts gewandt. Ihrem trans Sein begegnet sie mit der Distanz, der diesem Ansatz zu eigen ist. Sie bewegt sich damit in der Nähe von Renée Richards „Second Serve“ und Jan Morris „Rätsel/Conundrum“, die beide am Ende ihres Lebens mit trans Sein unversöhnlich blieben. Am Ende wollten sie nicht sein, was auch Duval nicht sein will, einfach eine Frau. Das Patriarchat fragt uns aber nicht, ob es uns gefällt, eine Frau zu sein, sondern macht mit unerbittlicher Erbarmungslosigkeit genau das aus uns. Dieses Frauenleben ist es, was gelebt werden will.
Duval, E. (2023). Nach Trans – Sex, Gender und die Linke. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin.