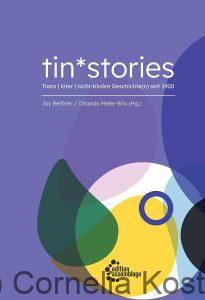Für die Beratung im Kontext von trans ist die seit dem 09.10.2018 in Kraft getretene S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung von Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit von großer Bedeutung. Für die praktische Arbeit habe ich eine Zusammenfassung, Neugliederung und Interpretation der Regelungen der S3-Leitlinie geschrieben.
Kurzversion – Was ist die informierte Einwilligung (informed consent) gemäß der S3-Leitlinie?
1. Der Zugang zu trans-spezifischen Gesundheitsdienstleistungen soll selbstbestimmt, informiert und frei sein, im Kontext von Autonomie und Entpathologisierung.
2. Für die Indikation einer transitionsunterstützenden Hormonbehandlung ist
a) eine Selbstauskunft und
b) eine positive Einschätzung der Entscheidungsfähigkeit
durch eine behandelnde Fachkraft ausreichend.
3. Im Sinne der partizipativen Entscheidungsfindung (shared decision making) sollen trans Personen gemeinsam mit den Behandelnden
a) alle Vor- und Nachteile abwägen und
b) ihre Entscheidungen für oder gegen einzelne Behandlungen im Austausch mit den Behandelnden treffen (S3-Leitlinie S. 10f).
4. Die Indikationsstellung erfolgt nicht aus dem psychiatrisch-psychotherapeutischen Fachgebiet, „prior informed consent“.
5. Peer-Beratungsstellen bieten kompetente Unterstützung aus einer professionalisierten Erfahrungsperspektive und im Rahmen der Beratung oder Behandlung ist die Kontaktaufnahme entsprechend zu fördern (S3-Leitlinie S. 99f).
Dabei sollen die Peers die Behandlungssuchenden
a) über die Risiken
b) sowie die kurz-, mittel- und langfristigen Konsequenzen der angestrebten Behandlung aufklären und
c) eine vollinformierte Entscheidung der Behandlungssuchenden gewährleisten.
Langversion – Peer Beratung
Im öffentlichen Diskurs über den Umgang mit trans Menschen in der Gesundheitsversorgung hat sich die Bedeutung des Begriffs informierte Einwilligung (informed consent) nochmals inhaltlich verschoben. Während die Basis für die Indikationsstellung der verschiedenen Behandlungsoptionen zunächst in einer sorgfältigen Diagnostik bei einem sexualmedizinisch/-therapeutisch weitergebildeten und mit GIK/GD vertrauten Behandelnden gesehen wurde (Nieder & Richter-Appelt, 2012), wird zunehmend die alleinige autonome Entscheidung der trans Person in den Vordergrund gestellt.
So betonen zum Beispiel Deutsch und Radix in dem von ihnen angewandten Modell des informed consent im Vorfeld einer transitionsunterstützenden Hormonbehandlung, dass eine Selbstauskunft und eine positive Einschätzung der Entscheidungsfähigkeit durch eine behandelnde Fachkraft ausreichend sein sollten (zitiert nach Eyssel, 2015; Radix & Eisfeld, 2014). Gefordert wird ein selbstbestimmter, informierter und freier Zugang zu trans-spezifischen Gesundheitsdienstleistungen ohne Indikationsstellung aus dem psychiatrisch-psychotherapeutischen Fachgebiet (prior informed consent).
Als Beispiel für einen solchen bereits realisierten Modus wird auf das 2012 in Argentinien erlassene Geschlechtsidentitätsgesetz verwiesen (vgl. Hamm & Sauer, 2014b). Die modifizierten inhaltlichen Aspekte des Begriffs informierte Einwilligung (informed consent) stehen im Zusammenhang mit den aus verschiedenen Disziplinen erhobenen und unterstützten Forderungen nach Autonomie und Entpathologisierung von trans Personen (siehe u. a. BMFSFJ, 2015). (S3-Leitlinie s. 12f)
Peer-Beratungsstellen können ebenfalls kompetente Unterstützung aus einer professionalisierten Erfahrungsperspektive bieten. Da trans Personen von Peers und/oder von Trans-Organisationen wichtige Informationen über potentielle Lösungsansätze für Arbeitskonflikte erhalten können, soll im Rahmen der Beratung oder Behandlung die Kontaktaufnahme entsprechend gefördert werden. (S3-Leitlinie S. 99f)
Die Adressat_innen der Leitlinie sollten nach Möglichkeit kontinuierlich Kontakt zur community basierten Beratung und/oder zur Peer-Szene der Behandlungssuchenden haben. Die Behandelnden sollen die Behandlungssuchenden über die Risiken sowie die kurz-, mittel- und langfristigen Konsequenzen der angestrebten Behandlung aufklären, um vollinformierte Entscheidungen der Behandlungssuchenden zu gewährleisten. Im Sinne der partizipativen Entscheidungsfindung (engl.: shared decision making) sollten trans Personen gemeinsam mit den Behandelnden alle Vor- und Nachteile abwägen und ihre Entscheidungen für oder gegen einzelne Behandlungen im Austausch mit den Behandelnden treffen. (S3-Leitlinie S. 10f)
Initiale Diagnostik (S. 22ff)
Die Feststellung der Diskrepanz zwischen Gender (Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle) und Zuweisungsgeschlecht wird zunächst von der behandlungssuchenden Person selbst getroffen. Es gibt keine objektiven Beurteilungskriterien, die den Behandelnden dafür zur Verfügung stünden.
Die Dauer und der Zeitaufwand für die initiale Diagnostik der GIK/GD ist fallbezogen variabel. Nach Möglichkeit sollte versucht werden, den diagnostischen Prozess so kurz wie möglich zu halten, um den Leidensdruck nicht unnötig zu verlängern und die Diagnosestellung nicht unnötig hinauszuzögern, da negative gesundheitliche Folgen für die Behandlungssuchenden bei einer Diagnostik von ungewisser Dauer evident sind. Eine Sicherung der Diagnose im Rahmen eines längerfristigen diagnostisch-therapeutischen Prozesses oder durch eine Verlaufsbeobachtung bzw. eine psychotherapeutisch begleitete Alltagserprobung, ist hinfällig. Eine die Diagnose sichernde Verlaufsbeobachtung ist dazu in der Regel nicht erforderlich.
Es soll erfasst werden, ob die Symptomatik konstant (seit mindestens sechs Monaten bestehend), vorübergehend oder intermittierend ist. Aus der isolierten Betrachtung von Zeitkriterien lässt sich keine Empfehlung zur Nicht-Behandlung herleiten. Die Vorgabe starrer Zeitkriterien vor der Möglichkeit, Maßnahmen zur Modifizierung der körperlichen Geschlechtsmerkmale zu empfehlen, entbehrt sowohl wissenschaftlicher als auch klinischer Grundlage.
Umgang mit Komorbiditäten (S. 23ff)
Es gibt weder aus klinischer noch aus wissenschaftlicher Sicht Kriterien oder Differentialdiagnosen, die eine GIK/GD von vornherein ausschließen. Die sexuelle Orientierung liefert keine diagnostisch relevante Information.
Ob durch die GIK/GD ein klinisch relevantes Leiden oder Funktionsstörungen verursacht werden, lässt sich in Fällen einer GIK/GD ohne begleitende psychische Störung oder mit einer leichten psychischen Störung wie beispielsweise einer Anpassungsstörung ebenfalls in der Regel im Rahmen der initialen Diagnostik rasch feststellen.
Bei begleitenden psychischen Störungen, wie beispielsweise einer affektiven Störung, einer sozialen Phobie oder Selbstverletzungsverhalten ist eine Verzögerung der Einleitung körpermodifizierender Behandlungen häufig nicht zielführend, da es durch die Einleitung entsprechender Maßnahmen (z. B. Hormon- und/oder Epilationsbehandlung) in vielen Fällen zu einer Remission sowohl der GIK/GD-Symptomatik als auch der psychischen Störung kommen kann.
Erst im Behandlungsverlauf lässt sich häufig unterscheiden, ob die Symptomatik reaktiv ist oder unabhängig von der GIK/GD besteht. Ein längerer diagnostischer Prozess vor der Einleitung körpermodifizierender Behandlungen ist nur gerechtfertigt, wenn der begründete Verdacht besteht, dass die begleitende psychische Störung die GIK/GD wesentlich mit beeinflusst. Dies kann ausschließlich im Einzelfall diagnostisch beurteilt werden.
Bei vorliegender aktueller psychotischer Symptomatik, Sonderformen der Dissoziativen Störung mit verschiedengeschlechtlichen Ego-States oder einer umfassenden Identitätsunsicherheit, ist ein längerer diagnostischer Prozess zu erwarten, um eine zuverlässige Beurteilung abgeben zu können.
Dies kann auch bei einem akuten, klinisch relevanten Substanzmissbrauch der Fall sein.
Bei diagnostischer Unsicherheit sollte eine Zweitsicht durch eine_n in Sachen GIK/GD erfahrene_n Expert_in erfolgen. Selbstverständlich kann auch ein längerer Prozess vor der Einleitung körpermodifizierender Behandlungen sinnvoll sein, wenn die behandlungssuchende Person sich noch nicht in der Lage fühlt zu entscheiden, welche Maßnahmen zur Linderung ihres Leidensdrucks geeignet sind. Dafür kann die Vermittlung an eine Community-basierte Beratung in besonderem Maße hilfreich sein, aber auch Aufklärungsgespräche mit Fachkolleg_innen der somatischen Fachbereiche.
Indikation (S.57)
Die Hormontherapie soll nach Abschluss der Diagnostik ermöglicht werden.
Der erschwerte Zugang zu einer Hormonbehandlung unter ärztlicher Betreuung führt dazu, dass manche Behandlungssuchende Hormonpräparate ohne professionelle Unterstützung einnehmen. In Anbetracht dessen, dass diese Praxis zu schwerwiegenden Konsequenzen führen kann, sollte im Rahmen einer Transitionsbegleitung
– die notwendige Vertrauensbasis geschaffen werden, damit die Betreffenden frühzeitig offen über ihre Eigenmedikation sprechen können.
– frühzeitig und unter Abwägung von Vor- und Nachteilen eine Überführung der bisherigen unbegleiteten hormonellen Behandlung in einen ärztlichen Behandlungsrahmen erfolgen.
Umfassende Diagnostik / Gutachten (S. 23ff)
Gerade bei der Erhebung der Anamnese der psychosexuellen Entwicklung ist eine von Respekt und Akzeptanz gekennzeichnete therapeutische Haltung von zentraler Bedeutung, um eine vertrauensvolle Gesprächssituation zu ermöglichen. Das Ziel einer solchen Anamneseerhebung ist es, ein ganzheitliches Verständnis von der individuellen Entwicklung der behandlungssuchenden Person zu erhalten.
Gleichwohl ist eine umfassende Diagnostik mit ganzheitlicher Betrachtung der behandlungssuchenden Person notwendig, um im gemeinsamen Dialog eine individuelle Lösung finden und zuverlässige Prognosen für einzelne in Frage kommende transitionsunterstützende Behandlungen stellen zu können. Im Rahmen dieses diagnostischen Prozesses sind die körperlichen, psychischen und sozialen Aspekte zu erfassen sowie auf kulturelle Besonderheiten zu achten. Eine umfassende Diagnostik ist auch erforderlich, um vorhandene Störungen oder Gesundheitsprobleme, die in einem Zusammenhang mit der GIK/GD stehen oder stehen könnten, einer adäquaten Behandlung zuführen zu können und mögliche Einschränkungen der Empfehlungen für medizinisch notwendige Modifikationen der körperlichen Geschlechtsmerkmale bereits frühzeitig abschätzen zu können.
Wichtig ist, den bereits vorhandenen oder zu erwartenden Leidensdruck einzuschätzen (vgl. Nieder & Güldenring, 2017). Auch wenn der seelische Leidensdruck ebenso wie körperlicher Schmerz nicht „messbar“ ist, stellt er die grundlegende Voraussetzung für alle folgenden Behandlungen dar. Unter sozialrechtlichen Gesichtspunkten werden medizinische und psychotherapeutische Behandlungen bei GIK/GD zu Lasten der Solidargemeinschaft dadurch legitimiert, dass sie zur Linderung des Leidensdrucks für erforderlich angesehen werden. Es sollte zudem erfasst werden, ob die Symptomatik konstant (seit mindestens sechs Monaten bestehend), vorübergehend oder intermittierend ist.
Die erste Säule einer umfassenden Diagnostik ist die ausführliche Anamneseerhebung der psychosexuellen Entwicklung. Hier berücksichtigt werden sollten wichtige Entwicklungsschritte vor und im Verlauf der Pubertät sowie in der Zeit nach der Pubertät. Von Bedeutung können auch bisherige Körper- und Beziehungserfahrungen sein, die Entwicklung der GIK bzw. GD über die Lebenszeit, des inneren und eventuell bereits erfolgten äußeren Comingout sowie die Reaktionen im sozialen Umfeld (Peer Group, Familie) auf das geschlechtsbezogene Verhalten, mit eventuellen Erfahrungen von Diskriminierung und Exklusion.
Bei der Geschlechtsdysphorie kann die Aversion gegen geschlechtsspezifische bzw. geschlechtstypische eigene Körpermerkmale stärker im Vordergrund stehen oder das Inkongruenzempfinden bezüglich der als unpassend erlebten sozialen Rolle und der daran anknüpfenden Ansprache und Behandlung in der Gesellschaft. Das Verlangen nach körpermodifizierenden Maßnahmen ist lediglich bei zwei der sechs A-Kriterien im DSM-5 für die GD von Bedeutung (APA., 2013). Es kann demzufolge vorhanden sein, muss es aber nicht, um eine GD diagnostizieren zu können.
Die zweite Säule ist darüber hinaus eine Sozialanamnese mit Erfassung der Wohnsituation, der schulischen bzw. beruflichen Situation, Partnerschaft, Familie, evtl. eigener Kinder, eine biographische Anamnese, bei der insbesondere auf belastende Lebensereignisse und familiäre Beziehungen und Entwicklungen zu achten ist, sowie eine medizinische Anamnese.
Bei der medizinischen Anamnese sind insbesondere Vorerkrankungen zu erfragen, durch die die therapeutischen Möglichkeiten eingeschränkt sein könnten (z. B. Thromboseneigung), aber auch Hinweise auf Varianten der (körperlichen) Geschlechtsentwicklung zu erfassen
Ergänzend sollte eine sorgfältige Befunderhebung des allgemeinen psychischen Befundes (z. B. nach AMDP) erfolgen. Eine diagnostische Aufgabe ist es dabei, eine Einschätzung zu treffen, inwieweit eine ggf. vorhandene psychische Störung eher als reaktiv (in den meisten Fällen), als gleichzeitig (das heißt aufgrund anderer Faktoren) oder als der GD vorausgegangen (eher Einzelfälle, z. B. bei einer Psychose mit wahnhafter Verkennung der eigenen Geschlechtszugehörigkeit) anzusehen ist. Zudem ist es wichtig, induzierende, aufrechterhaltende oder verstärkende Faktoren der GD sowie vorhandene Ressourcen mit besonderem Augenmerk auf die soziale Integration zu explorieren. Zu einer vollständigen Untersuchung gehört auch die Erfragung der Zukunftsperspektiven, ggfs. zur Familienplanung und zu einem möglichen Kinderwunsch.
Literatur:
Nieder, P. D. (09. 10 2018). S3 Leitlinie „Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit: Diagnostik, Beratung, Behandlung“. (D. G. (DGfS), Hrsg.) Abgerufen am 24. 02 2022 von AWMF: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/138-001.html