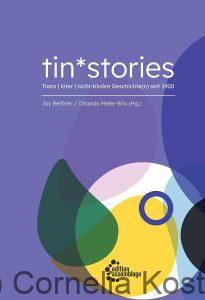Beratungsarbeit im Kontext von Transgeschlechtlichkeit und Komorbiditäten wie Sucht steht in mehreren Spannungsfeldern.
Für die Konzepte von „Diagnostik“ und „Komorbidität“ ist das Verständnis von Transgeschlechtlichkeit als Krankheit Bedingung. Die seit dem 09.10.2018 in Kraft getretene S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung von Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit räumt dem diagnostischem Prozess großen Raum ein.
So sagt sie zwar einerseits, dass es weder aus klinischer noch aus wissenschaftlicher Sicht Kriterien oder Differentialdiagnosen gibt, die eine Geschlechtsinkongruenz und/oder Geschlechtsdysphorie (GIK/GD) von vornherein ausschließen. Bei begleitenden psychischen Störungen wie beispielsweise einer affektiven Störung, einer sozialen Phobie oder Selbstverletzungsverhalten ist eine Verzögerung der Einleitung körpermodifizierender Behandlungen nicht zielführend, da es durch die Einleitung entsprechender Maßnahmen (z. B. Hormon- und/oder Epilationsbehandlung) in vielen Fällen zu einer Remission sowohl der GIK/GD-Symptomatik als auch der psychischen Störung kommen kann. Erst im Behandlungsverlauf lässt sich unterscheiden, ob die Symptomatik reaktiv ist oder unabhängig von der GIK/GD besteht (vgl. AWMF 2018, S. 22).
Allerdings sei ein längerer diagnostischer Prozess vor der Einleitung körpermodifizierender Behandlungen gerechtfertigt, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass die begleitende psychische Störung die GIK/GD wesentlich mitbeeinflusst. Das gilt insbesondere bei vorliegender aktueller psychotischer Symptomatik, Sonderformen der Dissoziativen Störung mit verschiedengeschlechtlichen Ego-States oder einer umfassenden Identitätsunsicherheit und bei einem akuten, klinisch relevanten Substanzmissbrauch (vgl. AWMF 2018, S. 22).
Es ist immer wieder zu beobachten, dass vorhandene Komorbiditäten zum Anlass genommen werden, trans Menschen in Behandlungen zu zwingen. Es wird unterstellt, dass die Komorbiditäten in einem Zusammenhang mit der GIK/GD stehen oder stehen könnten. Die medizinisch notwendigen Modifikationen der körperlichen Geschlechtsmerkmale werden den Menschen verwehrt und damit die Chancen, sie irgendwie doch zu erreichen, ungünstig beeinflusst.
Diagnostik ist vor allem durch die Vorgaben der MDS-Richtlinie an ein binäres Paradigma der Transgeschlechtlichkeit (Mann zu Frau, Frau zu Mann) gekoppelt. Auch die Vorstellung von einer Transition als linearem Behandlungsverlauf der körperlichen und sozialen Anpassung von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann fördert eine starke Erwartungshaltung bei den Behandler_innen und Klient_innen gleichermaßen (vgl. Renner et al. 2020). Es gibt das Ideal eines Prozesses, an dessen Anfang ein komorbiditätsfreier transgeschlechtlicher Mensch steht, der am Ende den gesellschaftlichen Identitätsvorgaben des Zielgeschlechtes körperlich und seelisch soweit wie möglich entsprechen soll.
Die diagnostischen Kriterien verwischen die Diversität von trans Personen hinsichtlich ihrer geschlechtlichen Selbstwahrnehmung und ihren Behandlungsanliegen. Nicht alle trans Personen halten körpermodifizierende Behandlungen für notwendig. Wenn sie sich als non-binär oder genderqueer verstehen, verfolgen sie teilweise ausgewählte Modifikationen. Dogmatismus und cis-heteronormative Vorstellungen bringen Menschen dazu, vorgezeichnete Wege zu gehen. Biografien werden entsprechend modifiziert, um in ein schwarz/weiß-Schema zu passen.
Diagnostik von Transgeschlechtlichkeit erfährt international einen Paradigmenwechsel, denn die Begriffe und die diagnostischen Kriterien verändern sich in Richtung einer Entpathologisierung. Gegenüber der ICD-10-Diagnose Transsexualismus F64.0, die für das deutsche Gesundheitssystem weiterhin sozialrechtlich verbindlich ist, ist die Geschlechtsinkongruenz in der ICD-11 nicht mehr als „psychischen Verhaltens- und Entwicklungsstörungen“ gelistet, sondern in einem neuen Kapitel zur sexuellen Gesundheit „Conditions related to sexual health“ (World Health Organization 2018) aufgenommen. Sie definiert „Geschlechts-Inkongruenz“ als „deutliche und anhaltende mangelnde Übereinstimmung zwischen dem erlebten und dem zugewiesenen Geschlecht“.
Nach DSM-5 (American Psychiatric Association 2013) liegt eine Geschlechtsdysphorie vor, wenn die Geschlechtsinkongruenz zu einem klinisch bedeutsamen Leidensdruck führt. Grundlage einer Behandlung ist nicht mehr die Trans-Identität, sondern die Geschlechtsdysphorie, also das Leiden unter der Geschlechtsinkongruenz.
Genauso wie die ICD-11-Diagnose Geschlechtsinkongruenz beschränkt sich die DSM-5-Diagnose Geschlechtsdysphorie nicht auf binäre Vorstellungen von Geschlechtlichkeit und schließt non-binäre Geschlechter ein. Die neue ICD 11 Klassifikation ist übrigens „Gender incongruence of adolescence or adulthood“ – HA60.
Weltweit besteht fachlicher Konsens darüber, dass trans Menschen eine ganzheitliche Gesundheitsförderung mit dem Zugang zu einer multimodalen, trans-informierten Gesundheitsversorgung erhalten sollen (Coleman et al. 2012; T’Sjoen et al. 2020; World Medical Association 2015). Transitionsunterstützende Behandlungen umfassen damit ein weites Spektrum möglicher Maßnahmen.
Weiterlesen: Therapiegrundsätze für trans